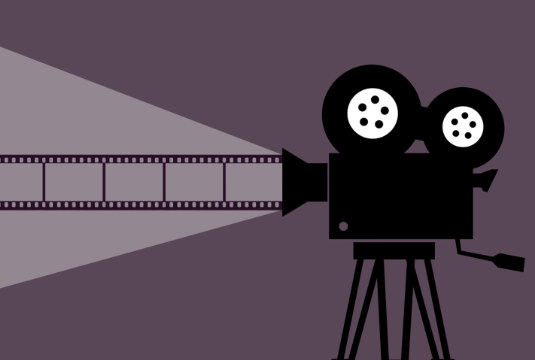In Love. Forever
Wie es ist, eine besondere Freundin zu haben. Und sie dann plötzlich zu verlieren. Ein Text über ungewollte Abschiede und das, was bleibt.
Prolog
Der Tod ist seltsam.
Manchmal schleicht er sich von hinten an, greift seinem Objekt der Begierde um den Hals und drückt einfach zu. Oder er kommt über Nacht, gleitet sanft von den umliegenden Bäumen auf das Dach des Hauses, landet lautlos auf dem Fensterbrett und schmiegt sich dann in die Kissen des Menschen, den er begehrt aufzusuchen.
Er hat so viele Gesichter.
Der Tod kommt in Begleitung tödlicher Krankheiten. Er macht uns das Leben schwer. Reicht es nicht, er käme alleine? Oder er zöge sich wieder zurück?
Als ich Dich das erste Mal im Hausflur in der Gethsemanestraße traf, das war im Sommer 2008. Wir wohnten in Berlin-Prenzlauer Berg. Ich war gerade in das Hinterhaus eingezogen, Aufgang römisch drei, III. Du wohntest über mir, auf der anderen Seite im 4. Stock. Die Wohnung war noch kleiner als meine, aber gut geschnitten. Auf dem Weg mit dem abgeratzten Kokosteppich zu Dir nach oben stand eine riesige Wasserpflanze mit Ablegern, die Du sorgfältig feucht hielst. Ich lernte schnell: Diese Frau bewegt sich viel, Treppensteigen macht ihr gar nichts. Und sie mag Grünes. Sehr.
Neue Nachbarin
Du warst braungebrannt von der Berliner und Brandenburger Sonne und hattest blaue, strahlende Augen, die mich wach und angenehm musterten. Aber was mir am meisten auffiel, das war Deine natürliche Art als Du mit mir dort das erste Mal sprachst. Wir sagten „Hallo“ und stellten uns gegenseitig vor. Es war eigentlich unspektakulär, ein Kennenlernen unter neuen Nachbarinnen, aber ich erinnere mich, wie ich danach dachte: Was für eine symphatische, natürliche Frau.
Eine Freundin von mir hat mal zu Studienzeiten einen revolutionären Satz gesagt: Sie sei in jeden ihrer Freunde und Freundinnen auch irgendwie verliebt. Wir redeten anschließend darüber, dass Verliebtsein nicht unbedingt immer mit Sex zu tun haben muss. Und dass man seine Freunde leidenschaftlich lieben kann. Dieser Satz passte sosehr zu mir, dass er mich fortan begleitete.
Eine Hausgemeinschaft
Wann ich mich genau in Dich verliebt habe, weiß ich nicht mehr. Vielleicht war es an dem Nachmittag als ich von der Redaktion nach Hause kam. Ich war als freie Journalistin für eine Tageszeitung tätig. Als dort der Gürtel immer enger geschnallt werden musste, wurde ich wie andere junge RedakteurInnen unschön geschasst. Zack, das war’s. Mir war hundeelend. Leichenblass kam ich von der Redaktion aus Mitte nach Hause und habe intuitiv sofort bei Dir geklingelt. Du hast mich reingelassen, ohne viele Worte, und mir einfach zugehört. Ich saß an dem Küchentisch, an dem wir viele Jahre später immer noch saßen, und habe Dir erzählt, wie tief getroffen ich sei von dieser Kündigung. Dieses – gänzlich frei von Vorurteilen – von Dir Angenommen-Werden und So-Sein-Können wie man ist in diesem Moment, das war eine der ganz großen Eigenschaften von Dir.
Voller Bewunderung
Unsere Nachbarschaft entwickelte sich zu einer Haus-, ja fast Lebensgemeinschaft. Du warst immer da, die Konstante in meinem Leben. Wir aßen zusammen, bekochten uns, wir machten Tee, luden uns gegenseitig ein. Ich mochte Deine pragmatische, naturverbundene Art und bewunderte Deine Fachkenntnisse zu Stadtplanung, Yoga, Ernährung, Bewegung und allen möglichen Orten in Brandenburg, die Du so gut kanntest.
Wir machten viele Ausflüge am Wochenende und die Berliner Bäderbetriebe unsicher. Dank Dir habe ich viele Schwimmbäder von innen gesehen, von Ost bis West. Wir machten Witze über die Beine anderer und lachten dabei gleichzeitig über unseren eigenen Speck und erste Dellen.
Unser Freundschaftsweg
Du lerntest alle meine Freunde kennen. Wir redeten über Partner im Speziellen, Männer im Allgemeinen und unsere Freiheit. Letztere war extrem wichtig für uns beide, aber Du gingst noch einen Schritt weiter und löstest Dich aus alten Konventionen. Die Spannungen und Auseinandersetzungen mit Deiner Familie, Deine gut durchdachten Entscheidungen zu Deinem Berufsweg, Dein Burn-Out und die Konsequenzen daraus – das waren Stationen auf unserem Freundschaftsweg. Für Deinen Willen, nach Deinem Gefühl zu leben und ganz eng bei Dir zu sein, bewunderte ich Dich unendlich.
Ich war beschützt
Als mich mein Job ins Ausland trug und raus aus unserer Gemeinschaft, war das nie ein Bruch. Ich wusste, dass Du nicht so international mobil bist. Es war einfach nicht Dein Ding, um die Welt zu jetten und Leute zu besuchen. Verbunden blieben wir dennoch über die vielen Berlinbesuche und unser Fundament, das so gut und fruchtbar über die vielen Jahre gewachsen war. Es ist seltsam – immer in meinem Leben, wenn ein Mensch ging, kam ein neuer. Sie ersetzten sich nicht gegenseitig, dazu waren sie einfach zu einmalig. Aber es war so, als würde jemand immer dafür Sorge tragen, dass ich beschützt bin, mit guten Menschen an meiner Seite. Du warst einer davon.
Ein Glück
Im letzten Oktober habe ich Dich dann noch einmal gesehen. Wir tranken Aperol Spritz an der Spree und ließen Stunden lang die Beine und Seele baumeln am sowjetischen Ehrendenkmal im Treptower Park. Du hattest das an, was ich immer den „Berlin-Style“ nenne – T-Shirt, alte Jeans, Laufschuhe. Die Stadt ist laissez-faire, es passte mal wieder alles zusammen und Du ganz mittendrin. Wir verabschiedeten uns und ich schaute Dir nochmal kurz nach an der S-Bahn. Die Sonne schien im Herbstlaub und ließ Dein Gesicht kurz aufleuchten: Was für eine geniale, tolle Frau. Was für ein Glück, diese Freundin zu haben!
Bonnbesuch
Wir redeten am Telefon über einen möglichen Bonn-Besuch. Ich sah Dich gedanklich in meiner gemütlichen Küche mit den Dachschrägen sitzen, mit Deinem wachen Blick und Deinen klugen Bemerkungen.
Das alles ist irgendwie nun vorbei. Und doch auch nicht.
Denn ich habe die Aufgabe, zu verstehen, dass Du jetzt tot bist.
Du Liebe
Als die Nachricht davon per E-Mail kam, musste ich mich rasch auf das Sofa setzen, das Du auch noch kennst aus meiner alten Wohnung. Ich glaube, ich habe kurz aufgeschrien. Drei Monate hast Du gekämpft mit Deiner Krebserkrankung, bis zur Erschöpfung und doch voller Hoffnung, dass Du es schaffen könntest und wieder gesundwirst. Deine Krankengeschichte ist eine kurze, heftige.
Am 11. Juli 2019 bist Du gestorben.
Dieses Glück, Dich gekannt zu haben und mit Dir befreundet gewesen zu sein, wird die Schatten überlagern. Und dann, da bin ich mir sicher, wird die Sonne wieder besonders golden strahlen. Vor allem an Deinem Lieblingsort. In Love. Forever!
In Love. Forever Weiterlesen »