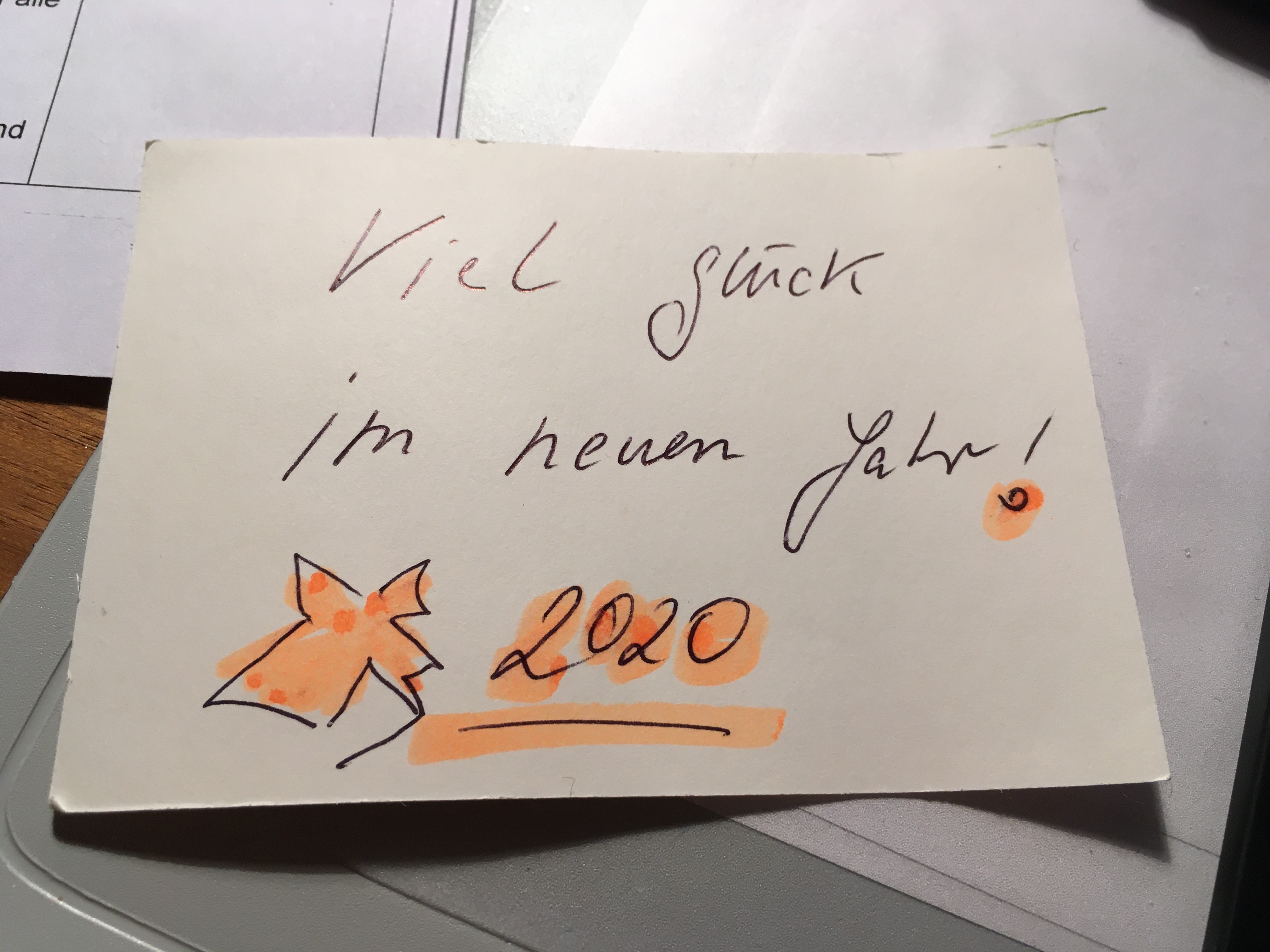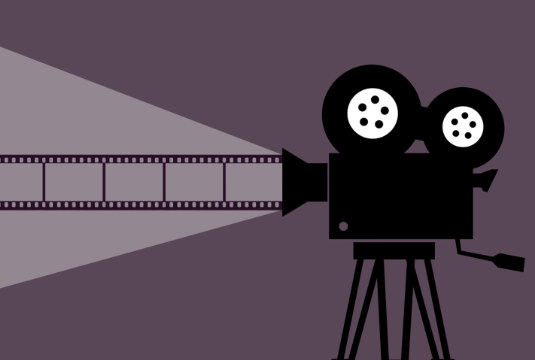Das warme Licht
Die aktuelle Krise in Palästina und Israel betrifft die Menschen am meisten, die dort leben. Sie berührt aber auch diejenigen, die Israel und Palästina gut kennen und schätzen. Können wir in einer Krise den Lichtschalter auf „warmes Licht“ einstellen? Gerade jetzt wäre das wünschenswert.
Eine Reflektion von Liva Haensel
Manchmal ist es gut, etwas naiv zu sein. Naivität erhellt das Leben, aber in einem weichen Licht. Naivität heißt, dass man nicht alles realistisch und nüchtern betrachtet. So, wie man sich sonst nur in einer grell erleuchteten Kleiderkabine eines deutschen Kaufhauses nüchtern im Spiegel anguckt, wenn man die neueste Bademode testet. Bademode anprobieren bei grellem Licht, das ist das Gegenteil von Rausch.
Das ist ein gnadenloser Zustand, so wie Gott einen eben schuf: Nackt, mit Falten, Hängebacken, Cellulitis, Knochen, hervortretenden Adern, mit Muskeln und Fettzellen an den falschen Stellen.
Mit Naivität wird das Licht in der Kabine weicher, stimmungsvoller, fließender. Das Schöne und Gute tritt hervor, und das beruhigt.
Eine Zeitlang, in der ich als Studentin in Berlin lebte, gewöhnte ich mir an, nur noch in wenige Klamottenläden zu gehen, deren Kabinenlicht man dimmen konnte. Wenn ich den Lichtschalter auf „warm“ anklickte, nahm ich mich anders wahr. Ich war noch dieselbe Person, aber ich sah jetzt anders aus. Die meisten Tops und Bikinis saßen dann und sie standen mir gut. Das warme, weiche Licht vor dem Spiegel schmeichelte mir. Meine von mir streng wahrgenommenen Schwachstellen traten in den Hintergrund. Ich wurde gnädiger mit mir.
Obwohl ich nicht viel Geld besaß im Studium, kaufte ich bei diesen Gelegenheiten meistens die Sachen, die ich bei diesem Licht anprobiert hatte. Später, als ich sie zuhause noch einmal testete, merkte ich, dass ich mit diesen Kleidungsstücken den guten Moment in der Kabine verband; denjenigen, in dem sich durch das Licht mein Spiegelbild mit meinem Selbst ausgesöhnt hatte. Es waren die Stücke, die ich später am liebsten und sehr oft trug.
Etwas Versöhnliches
Jetzt gerade merke ich, dass ich diesen Lichtschalter mit seinen unterschiedlichen Dimm-Stufen vermisse. Das weiche, warme Licht, das es gut meint mit uns Menschen. Dass etwas Versöhnliches hat, vielleicht Naives.
Ich kenne den Nahostkonflikt seit ich 19 Jahre alt bin. Das erste Mal fuhr ich mit meiner Familie nach Israel und Ägypten, da war ich 15. Damals konnten wir einfach nach Gaza reinfahren mit unserem israelischen Taxi, weil der Gazastreifen damals auch intern noch von Israel besetzt war.
Unsere zwei Tage in Jerusalem faszinierten mich damals so sehr, dass ich entschloss: In dieser Stadt möchte ich einmal für längere Zeit leben. Mein Interesse für die deutsch-jüdische Geschichte hatte sich schon ein paar Jahre vorher entwickelt. Wie viele andere junge Menschen in Deutschland wollte ich den Holocaust begreifen, das Dritte Reich, die Unglaublichkeit des Massenmordes der Nationalsozialist*innen. Wie war es soweit gekommen? Warum war das passiert? Bis heute beschäftigt mich diese Frage sehr. Ich denke, das ist gut so. Sie treibt mich an und lässt mich nie ganz ruhen.
Die Luft der Altstadt
Im Freiwilligendienst nach dem Abitur lebte ich in Jerusalems Altstadt, wo ich in einem Hospiz tätig war. Naiv war ich davon ausgegangen, dass es sich um Israels Staatsgebiet handelte. Erst nach und nach lernte ich, dass Ost-Jerusalem – so wie die Westbank, der Gazastreifen und die Golanhöhen – 1967 von Israel besetzt worden waren. In Ost-Jerusalem lebten Palästinenser*innen in dem muslimischen und christlichen Viertel, während in dem armenischen vornehmlich Armenier*innen und in dem jüdischen Viertel Jüdinnen und Juden lebten.
Mich faszinierte diese Vielfalt ungemein. Noch heute erinnere ich mich an die ersten Eindrücke nachdem ich in Jerusalem mit meinem Rucksack angekommen war: Ich sitze am Damaskustor auf den Stufen und schaue auf den Eingang in die Altstadt und die vielen Menschen. Orthodoxe eilen Richtung Klagemauer, arabische Frauen in traditionell bestickten Gewändern verkaufen Thymian auf Decken, die sie vor sich ausgebreitet haben. Zahlreiche Händler*innen ringen mit Tourist*innen um die besten Schekelpreise.
45 Minuten später in Jerusalem
Ich schließe die Augen und atme die Luft des Suks, des Basars, mit seinen Gewürzen, seinem Parfüm, der Minze, seinem Kaffee mit Kardamom und den von Öl getränkten Falafel Bällchen ein.
Ein Atemzug, tausend Gerüche. Die Altstadt brummt wie ein surrender Bienenkorb. In diesem Moment fühlte ich mich vollkommen zuhause.
Dieses Gefühl des Zuhause Seins hatte ich viele Male immer und immer wieder in Jerusalem. Meine Zeit als Volontärin hatte mich geprägt. Ich kehrte immer wieder in diese Stadt zurück und lebte dort für Monate oderJahre als Journalistin, Touristin, Menschenrechtsbeobachterin, Beraterin, Reisende und Heimkehrende. Sobald ich am Flughafen in Tel Aviv ankam, bestieg ich ein Sherut, ein israelisches Sammeltaxi, und war 45 Minuten später dort. Heimat.
Die Rückgabe wurde nicht erfüllt
Manchmal verloren wir uns etwas aus den Augen, die Stadt und ich. Dann schaffte ich es aus verschiedenen Gründen nicht, Jerusalem zu besuchen und ihren Glanz wahrzunehmen, weil mir mein alltägliches Leben dazwischenkam. Aber das machte nichts. Jerusalem war da und meine Liebe zu der Stadt blieb. Ich nahm Veränderungen wahr, die es früher nicht gegeben hatte: Den Checkpoint am Damaskus-Tor beispielsweise gab es früher nicht. Die Sicht auf die sich durch die engen Altstadtgassen schlängelnden Menschen war vollkommen freigewesen.
Mauerbau und Osloer Abkommen
Durch den Mauerbau Israels 2003 konnten sich viele Israelis und Palästinenser*innen nicht mehr in Jerusalem treffen und zusammen für Frieden arbeiten, so wie vorher. Die Freude über die Friedensverhandlungen und die Osloer Verträge ebbten Ende der 1990iger und zu Beginn des neuen Jahrtausends immer mehr ab. Die Palästinenser*innen hatten eine Rückgabe ihrer Gebiete erhofft und dass ihnen dies zumindest einen kleinen, eigenen Staat einbringen würde.
Doch die abgemachten fünf Jahre der Rückgabe – festgelegt in Oslo unter Aussparung der Antworten auf die Kernfragen Rückkehrrecht der Flüchtlinge, Status von Jerusalem, Grenzen und Regierungsstrukturen, Wasserressourcen – wurden nicht erfüllt. Verhandlungen und Friedensinitiativen endeten in Sackgassen Derweil beteten Jerusalems Menschen an der Klagemauer, in der Grabeskirche und im Felsendom weiter.
Eine tiefe Depression
Bis heute ist ein palästinensischer Staat nicht in Sicht und keine Hauptstadt für Palästinenser*innen. Die Westbank und Ost-Jerusalem sind nach wie vor völkerrechtswidrig von Israel besetzt. Dort leben mittlerweile 700.000 jüdische Siedler*iinnen. Die Zahl der Outposts – Mini-Siedlungen – die sich später in ganze Siedlungsketten einfügen – nehmen seit Jahren laut UN OCHA und der israelischen Organisation Peace Now zu. Einige Palästinenser*innen und Israelis können sich einen gemeinsamen Staat vorstellen, der zweifelsohne klare Regelungen bedingen müsste. Die Mantra artige Wiederholung der Zwei-Staatenlösung durch Politiker*innen hat bisher keine Ergebnisse gezeigt, die es beiden Völkern erlaubt, dort friedlich ohne Besatzung leben zu können.
Eine tiefe Depression, unterbrochen von andauernden Schockauslösern bedingt durch die sich stetig ändernde Nachrichtenlage und die immer höher kletternde Zahl von Todesopfern, ist eingetreten. Eine totale Unsicherheit hat sich wie Nebel ausgebreitet. Er umhüllt die Menschen in Israel und Palästina in ein graues, gefährliches Nichts.
We are so tired
„We are at the very end. Israel’s habitants want revenge now for the kidnapping and murder of the Hamas and I fear that the government will do so”, schreibt mir ein israelischer Freund über Facebook. Er hat jahrzehntelang in einer israelisch-palästinensischen Organisation für Frieden gearbeitet.
„We are so tired. We feel totally alone“, schreibt mir ein palästinensischer Freund, der sich jahrelang mit jüdischen Siedler*innen aus seiner Nachbarschaft zum gemeinsamen Essen traf.
Ich lege mein Handy weg und muss schlucken.
Ich suche den Lichtschalter im Dunkel. Ich möchte das Licht auf „Warm“ stellen, auf schön und fließend. Ich möchte die Falten und Wunden sehen, aber in einem guten Licht. Tastend bewege ich meine Finger nun vorwärts. Suchend.
Wo ist er?
Ich möchte meine Naivität wahren. Meinen Glauben daran, dass wir uns als Menschen immer wieder neu begegnen können – zusammen mit unseren Schmerzen, die sichtbar sind, die uns miteinander verbinden.
Ich vermisse das warme Licht.
Da ist er. Ich kann ihn fühlen. Es war dunkel und ich habe ihn nicht gesehen.
Ich streiche vorsichtig über seine kleine Erhebung. Der Lichtschalter ist noch da.